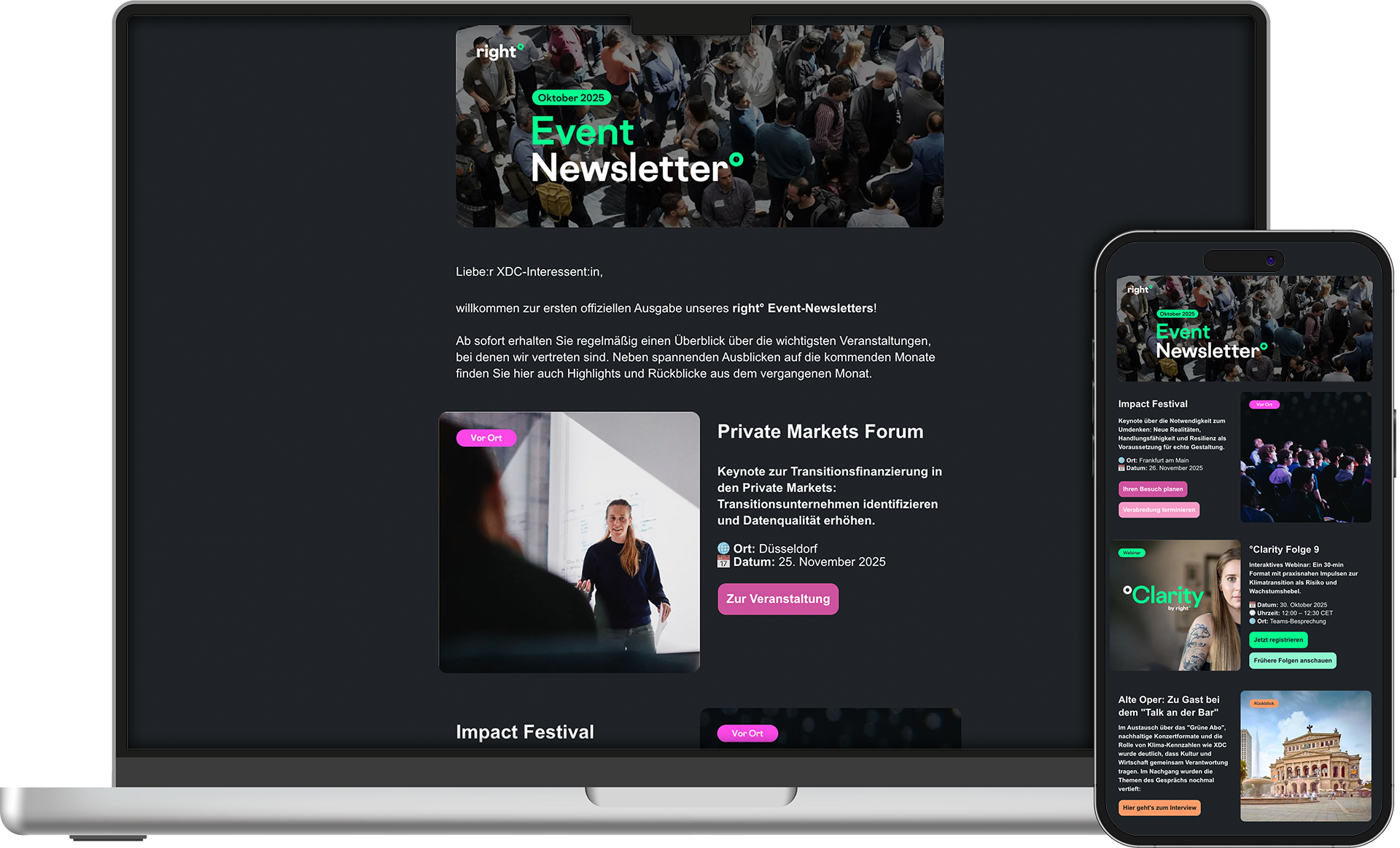04.02.2025
whatif-Interview: Stefan Rahmstorf
News

2024 haben wir unseren ersten whatif-Report veröffentlicht. Das Papier zeigt auf, was wäre, wenn die DAX-Unternehmen Deutschlands ihre Klimaziele erreichen würden. Wir haben die Klimawirkung dieser Unternehmen analysiert und vergleichbar gemacht – direkt in °C. Ab 2025 gehen wir einen Schritt weiter und analysieren die Klimawirkung sämtlicher DAX-Unternehmen.
In loser Reihenfolge diskutieren wir die Ergebnisse unserer Analyse und die daraus folgenden Schlussfolgerungen mit renommierten Expertinnen und Experten.
In unserem zweiten Interview zum whatif-Report diskutieren wir mit Stefan Rahmstorf über die Ergebnisse der whatif-Analyse 2024.
Stefan ist Professor für Physik der Ozeane an der Universität Potsdam und Leiter der Abteilung Erdsystemanalyse am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK). Seine Forschung konzentriert sich auf die Rolle der Ozeanzirkulation im Klimawandel. Als einer der Leitautoren des Vierten Sachstandsberichts des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) trug er maßgeblich zum Verständnis des Klimawandels bei. Für seine herausragenden Beiträge wurde er mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit der Alfred-Wegener-Medaille der European Geosciences Union im Jahr 2024
Hannah Helmke sprach mit Stefan über die globalen Risiken der Erderwärmung und nötige Maßnahmen zur Begrenzung auf 1,5 Grad, über den Sinn ambitionierter Klimaziele und warum gerade das oft gescholtene China vormacht, wie die ökologische Transformation der Wirtschaft aussehen kann.
Hannah Helmke: In unserem whatif-Report haben wir festgestellt, dass die 40 DAX-Unternehmen, wenn sie ihre Klimaziele erreichen, trotzdem zu einer 2,3 Grad Welt beitragen würden. Was würde eine Erde, die sich um 2,3 Grad erwärmt hat, konkret bedeuten?
Stefan Rahmstorf: Bereits jetzt liegen wir bei einer durchschnittlichen globalen Erwärmung von 1,3 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit. Das letzte Jahr erreichte sogar 1,6 Grad. Eine Welt mit 2,3 Grad Erwärmung ist nicht nur doppelt so problematisch wie bei 1,2 Grad, sondern viel schlimmer, da immer mehr Belastungsgrenzen überschritten werden.
Ein Beispiel dafür sind die zunehmenden Überschwemmungen, weil wärmere Ozeane mehr Verdunstung bewirken. Diese zusätzliche Feuchtigkeit regnet überwiegend in Form von Extremregen herunter.
Auch der Meeresspiegelanstieg wird sich bei 2,3 Grad weiter beschleunigen. Zudem drohen ganze Großsysteme des Klimas wie das Grönlandeis, die Westantarktis oder die Ozeanzirkulation Kipppunkte zu überschreiten.
Hannah Helmke: Du hast gerade die atlantische Umwälzzirkulation angesprochen, dein Forschungsschwerpunkt. Warum ist diese Strömung so wichtig, und was passiert, wenn sie in einer Welt mit 2,3 Grad Erwärmung versiegen würde?
Stefan Rahmstorf: Die atlantische Umwälzzirkulation ist der Grund für das relativ milde Klima in Nordwesteuropa. Je wärmer es wird, desto größer ist die Gefahr, dass diese Strömung einen Kipppunkt überschreitet und versiegt. Bereits jetzt gibt es Anzeichen für eine Abschwächung der Strömung.
Sollte die Umwälzzirkulation kippen, würde der Norden Europas deutlich kälter, während sich der Mittelmeerraum weiter aufheizt. Das hätte gravierende Folgen für die Landwirtschaft. Zudem würde der Temperaturkontrast zwischen Süd- und Nordeuropa zunehmen, was Wetterphänomene wie extreme Stürme und beispiellose Temperaturwechsel verstärken würde.
Die Folgen wären jedoch nicht auf Europa beschränkt. In den Tropen würden bisher regenreiche Regionen austrocknen, während andere Gebiete von extremen Regenfällen betroffen wären.
Hannah Helmke: Du vertrittst die These, dass das 1,5-Grad-Ziel noch erreichbar ist, wenn der politische Wille da wäre …
Stefan Rahmstorf: Viele Menschen glauben, dass es aufgrund der thermischen Trägheit des Klimasystems ohnehin nicht mehr zu erreichen sei. Doch das ist ein Irrtum. Selbst wenn wir letztes Jahr bei 1,6 Grad lagen, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass das Pariser Klimaziel verfehlt ist. Das Ziel bezieht sich auf den Langzeittrend. Physikalisch ist das 1,5-Grad-Ziel noch möglich. Die Emissionen müssen dafür bis 2030 halbiert werden. Es wäre machbar, wenn man es mit höchster Priorität behandeln würde – es bräuchte eine radikale Umstellung auf klimafreundliches Wirtschaften.
Hannah Helmke: Glaubst du, dass es besser wäre, wenn Unternehmen ambitionierte Klimaziele setzen, auch ohne einen konkreten Umsetzungsplan? Oder wäre es sinnvoller, realistischere, aber weniger ambitionierte Ziele zu formulieren, die jedoch nicht ausreichen, um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten?
Stefan Rahmstorf: Das ist eine schwierige Abwägung. Die Ziele müssen ambitioniert sein, damit sie nicht ständig verschärft werden müssen, wenn der Handlungsdruck durch zunehmende Extremwetterereignisse und immer höhere Klimaschäden steigt. Gleichzeitig sollten Unternehmen ernsthaft daran arbeiten, ihre Ziele zu erreichen, anstatt nur ambitionierte Ankündigungen zu machen. Unterschiedliche Branchen und Länder stehen vor verschiedenen Herausforderungen: Die Dekarbonisierung des Stromsystems ist technologisch bereits gut machbar, während Sektoren wie die Zement- oder Stahlproduktion deutlich komplexer sind.
Hannah Helmke: Du hast im Berliner Tagesspiegel betont, dass es vor allem auf die Gesamtmenge an ausgestoßenem CO₂ ankommt, nicht darauf, wann genau die Klimaneutralität erreicht wird. Viele Unternehmen behaupten, sie würden mit ihren Klimaneutralitätszielen zur Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze beitragen. Ist das tatsächlich der Fall?
Stefan Rahmstorf: Beim CO₂-Ausstoß zählt die Gesamtmenge, die bis zum Erreichen von Netto-Null in die Atmosphäre gelangt. Anders als Methan bleibt ein großer Teil des CO₂ Jahrtausende in der Atmosphäre, weshalb die kumulierten Emissionen entscheidend sind. Es reicht also nicht, irgendwann klimaneutral zu sein – wichtig ist, wie viel CO₂ wir bis dahin insgesamt emittieren.
Hannah Helmke: Warum gibt es dann von der EU und Deutschland nur das Ziel der Klimaneutralität, aber kein klares Ziel zur Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze?
Stefan Rahmstorf: Die EU und Deutschland haben zwar Zwischenziele auf dem Weg zur Klimaneutralität formuliert, doch diese sind nicht streng genug, um die 1,5-Grad-Grenze einzuhalten. Die zentrale Frage ist, wie man den fairen Anteil eines Landes an der globalen Emissionsminderung bestimmt. Der Umweltrat der Bundesregierung hat das getan und festgestellt, dass das deutsche CO₂-Budget für eine Begrenzung der Erderhitzung auf 1,5 °C bereits aufgebraucht ist.
Hannah Helmke: Es wirkt manchmal so, als würde die Zielsetzung absichtlich unklar gehalten, um sich auf dem Weg zur Zielerreichung möglichst flexibel bewegen zu können.
Stefan Rahmstorf: Tatsächlich herrscht eine gewisse gesellschaftliche Selbstverleugnung darüber, wie schnell wir aus der fossilen Energienutzung aussteigen müssten, um die Pariser Klimaziele einzuhalten. Politiker verstärken diesen Eindruck, indem sie behaupten, wir hätten noch zehn Jahre Zeit, um die richtigen Weichen zu stellen. Die Wahrheit ist jedoch: Wir stehen unter enormem Zeitdruck und müssen sofort und entschlossener handeln.
Hannah Helmke: Man sagt oft, wir hätten angesichts der Zukunftsaussichten die gesellschaftliche Verantwortung, bedingungslos optimistisch zu sein. Wie siehst du das?
Stefan Rahmstorf: Ich halte nichts von bedingungslosem Optimismus. Aber solange Hoffnung besteht, ist es unsere Pflicht, alles zu tun, um eine Klimakatastrophe abzuwenden. Ein schönes Beispiel ist die Energiewende: Die Fortschritte und das exponentielle Wachstum bei den Erneuerbaren-Energien zeigen, dass wir in einigen Bereichen schneller vorankommen, als viele Experten noch vor 10 oder 20 Jahren erwartet haben. Das sollten wir als Ansporn nehmen.
Gerade das viel gescholtene China, einer der größten CO₂-Emittenten, zeigt, wie es gehen kann. Dort wird massiv in grüne Technologien investiert. Nicht weil die besonders Öko sind, sondern aus wirtschaftlichem Kalkül. In Deutschland und Europa müssen wir aufpassen, nicht abgehängt zu werden. Denn die Welt bewegt sich in Richtung Nachhaltigkeit – und wir müssen sicherstellen, dass wir ein Teil davon sind, um nicht nur die Umwelt zu schützen, sondern auch unsere wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.
Zum whatif-Report 2024: https://right-basedonscience.de/reports/whatif-2024/
Auch im Jahr 2025 bieten wir einen monatlichen offenen Austausch zu XDC über die online-Terminserie °Clarity an. Mehr Informationen hier – wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
(c) Foto: Felix Amsel